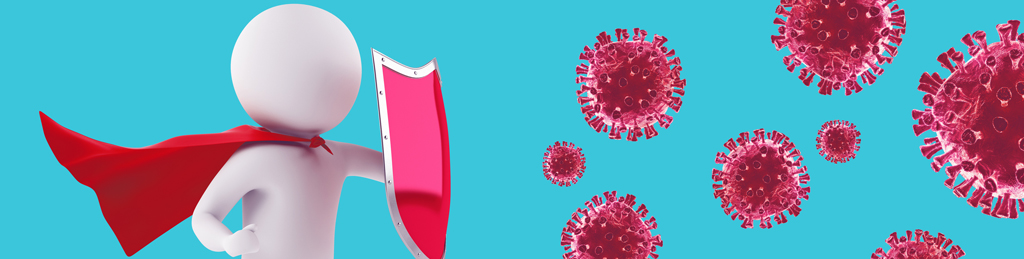
Immunabwehr: Von Klonkriegern und anderen Helden
Das Verteidigungssystem unseres Körpers: vielseitig, versiert, verblüffend
12.06.2023 – Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten – fortwährend stehen wir im Kontakt mit Kleinstlebewesen und anderen Mikroorganismen, die uns nicht immer freundlich gesonnen sind. Aber wie funktioniert eigentlich die Abwehr von Krankheitserregern? Hier erfahren Sie mehr über die zahlreichen kleinen Helden, die unermüdlich für unsere Sicherheit sorgen.
Unser Körper ist permanent Substanzen und Erregern ausgesetzt, die uns krank machen können. Dennoch besteht in der Regel kein Grund zur Sorge, denn es gibt auch eine gute Nachricht: Im Laufe der Evolution hat sich das Immunsystem entwickelt, um den menschlichen Organismus gegenüber schädlichen Einflüssen von außen und innen zu schützen. Es besteht aus einem komplexen Netzwerk aus Zellen und löslichen Substanzen. Sie sind in der Lage, Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten zu bekämpfen sowie geschädigte Körperzellen oder Krebszellen zu beseitigen. Die Komponenten dieses Netzwerks lassen sich dem angeborenen oder dem erworbenen, sogenannten adaptiven Immunsystem zuordnen [1, 2].
Anatomische Barrieren wie die Haut und Schleimhäute bilden eine Art mechanischen Schutzwall zwischen uns und unserer Umwelt. Hinzu kommen weitere Schutzmaßnahmen:
- Körperflüssigkeiten wie Speichel, Tränenflüssigkeit und Urin enthalten antimikrobielle Substanzen;
- Schleim auf den Schleimhäuten verhindert, dass sich Erreger an unsere Körperzellen anheften und in diese eindringen;
- Magensäure zerstört die meisten Erreger, welche über den Mund aufgenommen werden. [1, 2]
Die angeborene Immunantwort: Erste Abwehrfront im Körper
Werden die anatomischen Barrieren dennoch überwunden, etwa durch Verletzungen, bildet das angeborene Immunsystem die erste Abwehrfront. Bestimmte Strukturen auf der Oberfläche von Mikroorganismen haben sich über Jahrmillionen hinweg kaum verändert. Man spricht hier von evolutionär konservierten Motiven. Das Immunsystem hat im Laufe der Zeit gelernt, diese Oberflächenstrukturen als Fremdkörper zu erkennen. Die Abwehr erfolgt dabei nach einem stereotypen Muster und ermöglicht somit eine schnelle Reaktion, die eine Ausbreitung der Erreger verhindern soll.
Zu den löslichen Faktoren des angeborenen Immunsystems zählen eine Reihe von Eiweißen, welche die Erreger entweder direkt zerstören können oder diese für Immunzellen markieren. Anhand der Markierungen können Abwehrzellen die Erreger leichter erkennen. Auch bestimmte Botenstoffe, die sogenannten Zytokine, zählen zu den löslichen Komponenten des angeborenen Immunsystems. Mit Hilfe von Zytokinen können die Immunzellen miteinander kommunizieren. Als wichtige Signalgeber haben Zytokine auch die Aufgabe, inaktive Immunzellen in Alarmbereitschaft zu versetzen und sie gezielt zu Infektionsherden im Körper zu rekrutieren [1, 2]. Natürliche Killerzellen können Virus-infizierte Zellen oder Tumorzellen zerstören. Auch Fresszellen wie neutrophile Granulozyten, Monozyten und Makrophagen machen ihrem Namen alle Ehre: Sie beseitigen Zelltrümmer und sind in der Lage, Erreger in sich aufzunehmen und diese im Zellinneren zu zerstören. Indem Fresszellen bestimmte Zytokine am Ort des Infektionsgeschehens freisetzen, aktivieren und rekrutieren sie zudem weitere Immunzellen.
Dendritische Zellen (DC) gehören auch zu den Fresszellen, nehmen aber in der Immunabwehr noch eine weitere, zentrale Rolle ein: Sie verbinden das angeborene mit dem adaptiven Immunsystem [3, 4]. Als sogenannte professionelle Antigen-präsentierende Zellen nehmen sie laufend Stichproben aus ihrer Umgebung. Das aufgenommene Material wird im Zellinneren „ausgewertet“. Erkennen DC dabei spezielle Gefahrensignale (beispielsweise Zellwandbestandteile von Bakterien oder virale Nukleinsäuren), werden sie aktiv: Sie stellen spezifische Eiweißfragmente, sogenannte Antigene, gut „sichtbar“ zur Schau. Bestimmte Immunzellen des adaptiven Immunsystems – sogenannte T-Zellen – sind in der Lage, das jeweils präsentierte Antigen spezifisch zu erkennen.
| Das angeborene Immunsystem ist wichtig, um die Erreger schnell unter Kontrolle zu bringen und an einer vermehrten Ausbreitung zu hindern. Um sie jedoch vollständig zu eliminieren, wird das adaptive Immunsystem benötigt. Dieses ist äußerst anpassungsfähig und kann nicht nur evolutionär konservierte Motive erkennen, sondern auch neue und sich verändernde Erregerstrukturen. |
Die adaptive Immunantwort: Klonkrieger im Anmarsch
Das angeborene Immunsystem aktiviert das adaptive Immunsystem, welches Erreger Antigen-spezifisch erkennen kann und ein sogenanntes immunologisches Gedächtnis ausbildet. Aktivierte sogenannte T-Zellen (auch als T-Lymphozyten bezeichnet) teilen sich mehrfach, um zunächst eine ausreichende Zahl an Erreger-spezifischen Abwehrzellen zu generieren. Dabei entsteht aus einer spezifisch aktivierten T-Zelle eine Vielzahl an identischen Tochterzellen mit der gleichen Spezifität, ein sogenannter T-Zell-Klon. Die angeborene Immunabwehr hält den Erreger so lange in Schach, bis die adaptive Immunabwehr eine Vielzahl an T-Zell-Klonen generiert hat.
Die T-Lymphozyten werden in zytotoxische T-Zellen und T-Helferzellen unterteilt. Nach der Antigen-spezifischen Aktivierung der T-Lymphozyten durch DC können zytotoxische T-Zellen infizierte Zellen sowie Tumorzellen zerstören [1, 2]. Die T-Helferzellen lassen sich noch in verschiedene Subgruppen unterteilen. Sie unterstützen die Immunantwort, indem sie jeweils spezifische Zytokine freisetzen [5]. Im Gegensatz zur angeborenen Immunabwehr entwickelt die adaptive Immunantwort eine Abwehrstrategie, die individuell auf den jeweiligen Erreger zugeschnitten ist. Die Information, um welchen Erregertyp es sich handelt, bekommen die T-Helferzellen schon im Rahmen ihrer Aktivierung durch DC mit auf den Weg [6].
Eine weitere Aufgabe der T-Helferzellen ist es, B-Zellen (auch bekannt als B-Lymphozyten) zu aktivieren. Auch diese Zellen können nur Antigen-abhängig aktiviert werden und entwickeln sich anschließend zu sogenannten Plasmazellen. Diese sind in der Lage, Antikörper in die Umgebung abzugeben. Die löslichen Antikörper haben mehrere Funktionen im Rahmen der Immunabwehr:
- Sie neutralisieren Toxine,
- immobilisieren und markieren Krankheitserreger,
- aktivieren lösliche Komponenten des angeborenen Immunsystems und
- verstärken die Zerstörungskraft der natürlichen Killerzellen [1, 2].
Ein kleiner Teil der aktivierten T- und B-Lymphozyten bildet sich im Rahmen der Immunantwort zu Gedächtniszellen aus. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass das Immunsystem im Falle einer neuen Infektion mit dem gleichen Krankheitserreger nicht wieder „bei 0 anfangen“ muss. Stattdessen ermöglicht das immunologische Gedächtnis eine schnellere, stärkere und länger anhaltende Immunantwort [7, 8]. Auf diesem Prinzip beruhen auch Impfungen. Wenn das Immunsystem durch eine Impfung bereits ersten Kontakt mit dem entsprechenden Erreger hatte, bildet sich ein immunologisches Gedächtnis aus, welches uns im Falle einer Infektion schützt.
Sogenannte regulatorische T-Helferzellen sind wichtig, um die Immunantwort nach Elimination der Erreger wieder zu beenden. Zudem sorgen sie dafür, dass das Immunsystem nicht versehentlich körpereigene Strukturen angreift [9].
Quellen
- Abbas A, Lichtman A, Pillai S. Cellular and molecular Immunology. Elsevier Saunders. 2012;Edition 7
- Murphy K, Travers P, Walport M, Janeway C. Janeway’s Immunobiology. Garland Science. 2012;Edition 8.
- Mellman I. Dendritic cells: master regulators of the immune response. Cancer Immunol Res 2013; 1: 145-149
- Banchereau J, Briere F, Caux C et al. Immunobiology of dendritic cells. Annu Rev Immunol 2000; 18: 767-811
- Zhu J, Paul WE. CD4 T cells: fates, functions, and faults. Blood 2008; 112: 1557-1569
- Walsh KP, Mills KH. Dendritic cells and other innate determinants of T helper cell polarisation. Trends Immunol 2013; 34: 521-530
- Farber DL, Yudanin NA, Restifo NP. Human memory T cells: generation, compartmentalization and homeostasis. Nat Rev Immunol 2014; 14: 24-35
- Sallusto F, Lanzavecchia A, Araki K et al. From vaccines to memory and back. Immunity 2010; 33: 451-463
- Reiner SL. Development in motion: helper T cells at work. Cell 2007; 129: 33-36
Autorin dieses Beitrags: Dr. Antje Tunger, medizinwelten-services GmbH, Stuttgart
Gefällt Ihnen der Text? Erwerben Sie hier die Rechte an diesem Artikel.
Fachgebiet (Unterfachgebiet):
Allgemeinmedizin, Öffentliches Gesundheitswesen, Immunologie
Körperregion/Organsystem:
Immunsystem
Jahreszeit:
Frühling, Sommer, Herbst, Winter
Anlass:
/
Medizinischer Bereich:
Immunologie, Infektionskrankheiten, Autoimmunerkrankungen
Schlagwörter:
Antigen, Antikörper, B-Lymphozyten, Dendritische Zellen, Fresszellen, Gedächtniszellen, Immunabwehr, Immunsystem, Impfung, natürliche Killerzellen, neutrophile Granulozyten, Makrophagen, Monozyten, T-Lymphozyten, Zytokine